 Hiob fragt beharrlich weiter. Und dies, obwohl seine Freunde schon ganz genau den Grund seines Leidens kennen: Irgendwo, zumindest unbewusst muss er Schuld auf sich geladen haben! Bereits die Propheten wettern ja ständig, dass Leiden und Verbannung die Konsequenz aus gottlosem Tun sind. Doch so klug sie auch reden – sie helfen dem Freund gerade nicht in seiner Not. Aus dem Anfang der Geschichte wissen wir: Hiob kann wirklich nichts für sein Leid. Der Satan will zeigen, dass er nur deshalb fromm ist, weil es ihm gut geht. Hiob ringt weiter mit diesem Gott, der sich ihm völlig ins Dunkle entzieht. =>
Hiob fragt beharrlich weiter. Und dies, obwohl seine Freunde schon ganz genau den Grund seines Leidens kennen: Irgendwo, zumindest unbewusst muss er Schuld auf sich geladen haben! Bereits die Propheten wettern ja ständig, dass Leiden und Verbannung die Konsequenz aus gottlosem Tun sind. Doch so klug sie auch reden – sie helfen dem Freund gerade nicht in seiner Not. Aus dem Anfang der Geschichte wissen wir: Hiob kann wirklich nichts für sein Leid. Der Satan will zeigen, dass er nur deshalb fromm ist, weil es ihm gut geht. Hiob ringt weiter mit diesem Gott, der sich ihm völlig ins Dunkle entzieht. =>
Was wir mit neuen Grenzen verlieren
 „Werden wir an der Grenze Zeit verlieren?“ Diese Frage stellten wir uns vor unserem Urlaub auf dem polnischen Ostseeküsten-Radweg von Danzig zurück nach Usedom. Denn seit Monaten häuften sich die Meldungen über verschärfte Kontrollen im Osten. Die Realität war unspektakulär: Der Zug fuhr an der Grenze nur etwas langsamer. Und zurück auf dem Europa-Radweg entlang der Ostsee hinter Swinemünde war die Grenze zwar markiert, doch standen dort nur auf polnischer Seite drei Grenzer in ein Gespräch vertieft. Nun gut, wir haben jetzt nicht stundenlang auf einen Einsatz dort gewartet, doch waren viele Radler mit schwerem Gepäck unterwegs. Also leere Symbolpolitik? =>
„Werden wir an der Grenze Zeit verlieren?“ Diese Frage stellten wir uns vor unserem Urlaub auf dem polnischen Ostseeküsten-Radweg von Danzig zurück nach Usedom. Denn seit Monaten häuften sich die Meldungen über verschärfte Kontrollen im Osten. Die Realität war unspektakulär: Der Zug fuhr an der Grenze nur etwas langsamer. Und zurück auf dem Europa-Radweg entlang der Ostsee hinter Swinemünde war die Grenze zwar markiert, doch standen dort nur auf polnischer Seite drei Grenzer in ein Gespräch vertieft. Nun gut, wir haben jetzt nicht stundenlang auf einen Einsatz dort gewartet, doch waren viele Radler mit schwerem Gepäck unterwegs. Also leere Symbolpolitik? =>
Aus vereinten Wurzeln den Aufbruch wagen
 „Wir wollen die Partnerschaft nach gut 40 Jahren in die neue Generation tragen“, erklärt Klaus Eberius. Er ist nicht nur Pfarrer in Schillingsfürst, sondern auch Partnerschaftsbeauftragter des Dekanats Rothenburg mit dem Dekanat Hai in Tansania. Direkt an den Hängen des Kilimandscharo gelegen, umfasst Hai inzwischen 49 Gemeinden mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Der damalige Rothenburger Dekan Johannes Rau und seine afrikanischen Partner legten 1982 das Fundament für diese Beziehung zwischen zwei Kirchen auf zwei Kontinenten.
„Wir wollen die Partnerschaft nach gut 40 Jahren in die neue Generation tragen“, erklärt Klaus Eberius. Er ist nicht nur Pfarrer in Schillingsfürst, sondern auch Partnerschaftsbeauftragter des Dekanats Rothenburg mit dem Dekanat Hai in Tansania. Direkt an den Hängen des Kilimandscharo gelegen, umfasst Hai inzwischen 49 Gemeinden mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Der damalige Rothenburger Dekan Johannes Rau und seine afrikanischen Partner legten 1982 das Fundament für diese Beziehung zwischen zwei Kirchen auf zwei Kontinenten.
Ab Mitte September soll diese Verbindung eine neue Tiefe bekommen: Sechs junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren reisen aus Tansania ins Taubertal – drei Frauen und drei Männer … =>
Zwiespältiger Aufbruch zur Einheit
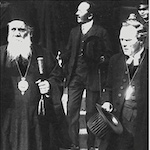 Hätten die Kirchen den Ersten Weltkrieg verhindern können, wenn sie nur frühzeitig gemeinsam ihre Stimme gegen Nationalismus und Militarismus erhoben hätten? Aber auch nach dem Ende der Kämpfe klafften die Wunden weiter – zwischen den Völkern ebenso wie zwischen ihren Kirchen. Die Gräben waren nicht nur politisch, sondern tief in die geistliche Landschaft Europas eingeschnitten. Einer, der sich dieser zerrissenen Welt nicht einfach beugte, war der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom (1866–1931). Als Kirchenmann aus einem neutral gebliebenen Land war es ihm möglich, Brücken zu bauen. Trugen sie? =>
Hätten die Kirchen den Ersten Weltkrieg verhindern können, wenn sie nur frühzeitig gemeinsam ihre Stimme gegen Nationalismus und Militarismus erhoben hätten? Aber auch nach dem Ende der Kämpfe klafften die Wunden weiter – zwischen den Völkern ebenso wie zwischen ihren Kirchen. Die Gräben waren nicht nur politisch, sondern tief in die geistliche Landschaft Europas eingeschnitten. Einer, der sich dieser zerrissenen Welt nicht einfach beugte, war der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom (1866–1931). Als Kirchenmann aus einem neutral gebliebenen Land war es ihm möglich, Brücken zu bauen. Trugen sie? =>
Vom Geier gelernt: Wie Gleichgültigkeit tötet
 „Der Geier und das kleine Kind“: Lang ist es her, dass dies Bild um die Welt ging. Es zeigt ein ausgemergeltes Kind, zusammengesunken auf staubtrockener Erde. Wenige Schritte entfernt lauert ein Geier – bereit, sich auf das Leben zu stürzen, das kaum noch eines war. 1993 entstand das Bild im heutigen Südsudan. Der Fotograf Kevin Carter erhielt dafür den Pulitzer-Preis – und bittere Kritik. Warum hatte er nicht geholfen? Kurze Zeit später nahm sich Carter das Leben. Schon damals herrschte im Sudan eine tödliche Hungersnot, verursacht durch Bürgerkrieg und politisch kalkulierte Blockaden. Der damalige Diktator Hasan Ahmad al-Baschir verweigerte Hilfslieferungen – hunderttausende Menschen verhungerten. Der Geier musste nicht lange warten. Und das Kind auf dem Bild? =>
„Der Geier und das kleine Kind“: Lang ist es her, dass dies Bild um die Welt ging. Es zeigt ein ausgemergeltes Kind, zusammengesunken auf staubtrockener Erde. Wenige Schritte entfernt lauert ein Geier – bereit, sich auf das Leben zu stürzen, das kaum noch eines war. 1993 entstand das Bild im heutigen Südsudan. Der Fotograf Kevin Carter erhielt dafür den Pulitzer-Preis – und bittere Kritik. Warum hatte er nicht geholfen? Kurze Zeit später nahm sich Carter das Leben. Schon damals herrschte im Sudan eine tödliche Hungersnot, verursacht durch Bürgerkrieg und politisch kalkulierte Blockaden. Der damalige Diktator Hasan Ahmad al-Baschir verweigerte Hilfslieferungen – hunderttausende Menschen verhungerten. Der Geier musste nicht lange warten. Und das Kind auf dem Bild? =>
Hoffnungszeichen trotz aller Rückschläge?
 Aus christlichen Werten entstanden Hoffnungszeichen: Vor 50 Jahren, am 1. August 1975, wurde in Helsinki ein Abkommen unterzeichnet, dessen Geist bis heute besteht. Und dies mit dem sehr technischen und nichtssagenden Titel „KSZE-Schlussakte“! Inmitten des Kalten Krieges einigten sich die Länder Europas und Nordamerikas östlich und westlich des Eisernen Vorhangs erstmals offiziell auf die Unverletzlichkeit von Grenzen, die friedliche Streitbeilegung und die Achtung der Menschenrechte. Ein klassisches diplomatisches Tauschgeschäft – dessen Geist eine unerwartete Sprengkraft erfuhr. =>
Aus christlichen Werten entstanden Hoffnungszeichen: Vor 50 Jahren, am 1. August 1975, wurde in Helsinki ein Abkommen unterzeichnet, dessen Geist bis heute besteht. Und dies mit dem sehr technischen und nichtssagenden Titel „KSZE-Schlussakte“! Inmitten des Kalten Krieges einigten sich die Länder Europas und Nordamerikas östlich und westlich des Eisernen Vorhangs erstmals offiziell auf die Unverletzlichkeit von Grenzen, die friedliche Streitbeilegung und die Achtung der Menschenrechte. Ein klassisches diplomatisches Tauschgeschäft – dessen Geist eine unerwartete Sprengkraft erfuhr. =>
Filmreif verwickelt
 Ein Stück im Stück – genauer: ein Film im Freilandtheater: Diese komplexe Erzählkonstruktion wagt das Freilandtheater mit seinem aktuellen Stück „Abgedreht“. Die Rahmenhandlung spielt im Jahr 1927 in einem mittelfränkischen Dorf, das um seine Zukunft bangt. Der Bürgermeister hat eine neuartige Idee: Ein Berliner Filmteam soll ein Historiendrama drehen – und zwar direkt in der Dorfidylle. Schließlich hat ein Dorfbursche begonnen, als Kameramann in der weiten Welt Karriere zu machen. Und welche Rolle spielt da ein dunkler und blinder Kapuzenmann? =>
Ein Stück im Stück – genauer: ein Film im Freilandtheater: Diese komplexe Erzählkonstruktion wagt das Freilandtheater mit seinem aktuellen Stück „Abgedreht“. Die Rahmenhandlung spielt im Jahr 1927 in einem mittelfränkischen Dorf, das um seine Zukunft bangt. Der Bürgermeister hat eine neuartige Idee: Ein Berliner Filmteam soll ein Historiendrama drehen – und zwar direkt in der Dorfidylle. Schließlich hat ein Dorfbursche begonnen, als Kameramann in der weiten Welt Karriere zu machen. Und welche Rolle spielt da ein dunkler und blinder Kapuzenmann? =>
Madonna und Monster, Muse und Mächtige?
 Selig betrachtet sie ihr Kind: Die gotische Madonnenfigur aus der Zeit um 1400 genauso wie die „Stillende Mutter“ von Paula Modersohn-Becker ein halbes Jahrtausend später. Zwar erschien letztere bei ihrer Entstehung fast schockierend entblößt, doch in ihrer inneren Ausrichtung auf ihr Baby übertrifft sie viele Madonnen. Und dies auch, obwohl ihr Kind den Blick von ihr und der Nahrungsquelle abgewendet hat und anscheinend geradewegs auf uns Betrachtende aus dem Bild herausschaut. Dies sind nur zwei von 120 Exponaten aus sechs Jahrhunderten, die die Ausstellung „Mama – von Maria bis Merkel“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt. Ein drittes Werk spannt den Bogen weiter … =>
Selig betrachtet sie ihr Kind: Die gotische Madonnenfigur aus der Zeit um 1400 genauso wie die „Stillende Mutter“ von Paula Modersohn-Becker ein halbes Jahrtausend später. Zwar erschien letztere bei ihrer Entstehung fast schockierend entblößt, doch in ihrer inneren Ausrichtung auf ihr Baby übertrifft sie viele Madonnen. Und dies auch, obwohl ihr Kind den Blick von ihr und der Nahrungsquelle abgewendet hat und anscheinend geradewegs auf uns Betrachtende aus dem Bild herausschaut. Dies sind nur zwei von 120 Exponaten aus sechs Jahrhunderten, die die Ausstellung „Mama – von Maria bis Merkel“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt. Ein drittes Werk spannt den Bogen weiter … =>
Witz als Mittel der Wahrheitssuche
 „Du meinst, das Zepter verleiht Macht, weil alle daran glauben, dass es Macht verleiht?“ So fragt die 13-jährige Ada ihren Vater Elos. Sie leben in einer magischen Welt, die in mittelalterlichen Strukturen erstarrt zu sein scheint. Auf den ersten Blick wirken „Die Spurenfinder und das Drachenzepter“ wie ein klassisches Fantasy-Abenteuer. Es ist für Jugendliche ab etwa zwölf Jahren gedacht. Gleichzeitig kommt es sprachlich leichtfüßig daher. Doch unter der spannenden Oberfläche und den pointierten Dialogen verbirgt sich mehr in dem neuen Werk, das Marc-Uwe Kling mit seinen Töchtern Johanna, Luise und Elisabeth geschrieben hat: Eine Auseinandersetzung über Themen wie Erinnerung, Wahrheit, Verantwortung und Generationswechsel – mit viel Tiefgang auch für Erwachsene. =>
„Du meinst, das Zepter verleiht Macht, weil alle daran glauben, dass es Macht verleiht?“ So fragt die 13-jährige Ada ihren Vater Elos. Sie leben in einer magischen Welt, die in mittelalterlichen Strukturen erstarrt zu sein scheint. Auf den ersten Blick wirken „Die Spurenfinder und das Drachenzepter“ wie ein klassisches Fantasy-Abenteuer. Es ist für Jugendliche ab etwa zwölf Jahren gedacht. Gleichzeitig kommt es sprachlich leichtfüßig daher. Doch unter der spannenden Oberfläche und den pointierten Dialogen verbirgt sich mehr in dem neuen Werk, das Marc-Uwe Kling mit seinen Töchtern Johanna, Luise und Elisabeth geschrieben hat: Eine Auseinandersetzung über Themen wie Erinnerung, Wahrheit, Verantwortung und Generationswechsel – mit viel Tiefgang auch für Erwachsene. =>
Eine Nacht im Dazwischen – offen für eine „Weiße Nacht“
 Eine ganz Nacht in einem Strandkorb zu verbringen – mutterseelenallein, nur das Firmament über mir! Und die Wellen nicht weit! Dazu hatte ich noch ein Geschenk an der Ostseeküste einzulösen. Denn es war keine „Challenge“, keine persönliche Herausforderung oder Selbstüberwindung, sondern durchaus eine gebuchte Übernachtung wie in einem Hotel. Dafür auch erstaunlich bequem, denn es war ein Liege-Strandkorb, in dem ich mich gut ausstrecken konnte. Ich saß im Dazwischen – zwischen Tag und Nacht, zwischen Öffentlichkeit und Rückzug … =>
Eine ganz Nacht in einem Strandkorb zu verbringen – mutterseelenallein, nur das Firmament über mir! Und die Wellen nicht weit! Dazu hatte ich noch ein Geschenk an der Ostseeküste einzulösen. Denn es war keine „Challenge“, keine persönliche Herausforderung oder Selbstüberwindung, sondern durchaus eine gebuchte Übernachtung wie in einem Hotel. Dafür auch erstaunlich bequem, denn es war ein Liege-Strandkorb, in dem ich mich gut ausstrecken konnte. Ich saß im Dazwischen – zwischen Tag und Nacht, zwischen Öffentlichkeit und Rückzug … =>
