 „Da konnte ich nur einen Schelmenroman schreiben“, so Leonhard F. Seidl über seinen neuen Rothenburg-Roman. Der „Besuch eines Kaisers in der Reichsstadt“ faszinierte ihn besonders: genauer gesagt die Stippvisite des damaligen Schahs Mohammad Reza Pahlavi mitsamt der bezaubernden Farah Diba an der Tauber im Sommer 1967. Wenige Tage später, am 2. Juni 1967, als das Herrscherpaar nach Berlin weitergereist war, kam es dort zu den denkwürdigen Demonstrationen gegen den Schah, die in der Ermordung Benno Ohnesorgs gipfelten. Noch aber sind wir längst nicht so weit: Vor der Tragödie liegt die Posse. =>
„Da konnte ich nur einen Schelmenroman schreiben“, so Leonhard F. Seidl über seinen neuen Rothenburg-Roman. Der „Besuch eines Kaisers in der Reichsstadt“ faszinierte ihn besonders: genauer gesagt die Stippvisite des damaligen Schahs Mohammad Reza Pahlavi mitsamt der bezaubernden Farah Diba an der Tauber im Sommer 1967. Wenige Tage später, am 2. Juni 1967, als das Herrscherpaar nach Berlin weitergereist war, kam es dort zu den denkwürdigen Demonstrationen gegen den Schah, die in der Ermordung Benno Ohnesorgs gipfelten. Noch aber sind wir längst nicht so weit: Vor der Tragödie liegt die Posse. =>
Schwindelfreie und vorwitzige Engel
 Die Engel sind unterwegs. Gerade am Ende dieses Corona-Jahres haben uns die Himmelsboten offenbar mehr zu sagen als zu anderen Zeiten. Doch auch die weihnachtlichen Gemälde alter Meister aus der Zeitenwende um 1500 bevölkern variantenreiche Engel. Da balancieren ihre Darstellungen auch den Wandel der Vorstellungen. Was geschah da bei schwindelfreier Ansicht? Benno Baumbauer ist Leiter der „Sammlung Malerei bis 1800 und Glasmalerei“ im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Es ist nun aufgrund der Corona-Lage geschlossen. Doch Baumbauer hat in einem Zoom-Gespräch eine kleine Auswahl der alten Werke für das Sonntagsblatt vorgestellt. =>
Die Engel sind unterwegs. Gerade am Ende dieses Corona-Jahres haben uns die Himmelsboten offenbar mehr zu sagen als zu anderen Zeiten. Doch auch die weihnachtlichen Gemälde alter Meister aus der Zeitenwende um 1500 bevölkern variantenreiche Engel. Da balancieren ihre Darstellungen auch den Wandel der Vorstellungen. Was geschah da bei schwindelfreier Ansicht? Benno Baumbauer ist Leiter der „Sammlung Malerei bis 1800 und Glasmalerei“ im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Es ist nun aufgrund der Corona-Lage geschlossen. Doch Baumbauer hat in einem Zoom-Gespräch eine kleine Auswahl der alten Werke für das Sonntagsblatt vorgestellt. =>
Hoffnung gegen Hilflosigkeit
Außer Paracetamol und einem Malaria-Medikament gibt es keine Behandlung.“ Die aktuelle gesundheitliche Situation in Sierra Leone fasst Carmen Schöngraf, Geschäftsführerin der ora-Kinderhilfe, mit diesem Satz zusammen. Dreißig Stunden war sie unterwegs – nur für die Rückreise Anfang Dezember nach Berlin. Doch „wir haben gemerkt, wie die digitale Begleitung unserer Projekte dort an ihre Grenzen kam.“ So führte sie ihre erste Auslandsreise in diesem Corona-Jahr in eines der ärmsten Länder der Welt. Seit den Zeiten des Bürgerkrieges in dem Jahrzehnt nach 1991 bestimmen Armut, Krankheit und Perspektivlosigkeit das Leben dort. Die Ebola-Epidemie in den Jahren 2014/15 verschlimmerte zusätzlich das Elend dort. =>
Prägende Begegnungen des Dichters Paul Celan
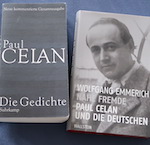 Von deinem Gott war die Rede, ich sprach / gegen ihn, ich / ließ das Herz, das ich hatte, / hoffen: / auf / sein höchstes, umröcheltes, sein / haderndes Wort –.“ Nach einem intensiven Gespräch mit Nelly Sachs, die in Schweden den Holocaust seelisch verwundet überlebt hatte, dichtete Paul Celan dieses 1960. Theo Buck zitiert diese Sätze in seiner Celan-Biografie zum 100. Geburtstag des Dichters. Am 23. November 1920 erblickte er als Paul Antschel das Licht der Welt – und zwar in Czernowitz in der Bukowina. Er kam aus einer jüdischen, deutschsprachigen Familie. Viele Dichter von Rose Ausländer bis zu Immanuel Weissglas entstammen damals demselben Ort. Bekanntheit erlangte er als Dichter der „Todesfuge“. =>
Von deinem Gott war die Rede, ich sprach / gegen ihn, ich / ließ das Herz, das ich hatte, / hoffen: / auf / sein höchstes, umröcheltes, sein / haderndes Wort –.“ Nach einem intensiven Gespräch mit Nelly Sachs, die in Schweden den Holocaust seelisch verwundet überlebt hatte, dichtete Paul Celan dieses 1960. Theo Buck zitiert diese Sätze in seiner Celan-Biografie zum 100. Geburtstag des Dichters. Am 23. November 1920 erblickte er als Paul Antschel das Licht der Welt – und zwar in Czernowitz in der Bukowina. Er kam aus einer jüdischen, deutschsprachigen Familie. Viele Dichter von Rose Ausländer bis zu Immanuel Weissglas entstammen damals demselben Ort. Bekanntheit erlangte er als Dichter der „Todesfuge“. =>
Neue Erfahrungen gewinnen Raum
 „Spiele, die Spaß machen, dürfen nicht sein.“ Diese Klage hörte Pfarrerin Eva Forssmann, als sie die Kinderbibeltage der Kirchengemeinde Leutershausen zusammen mit Dekanatsjugendreferentin Anna Wiemer und Pfarrerin Teresa Sichermann vorbereitete. In der ersten Hälfte der Herbstferien luden sie dazu ein – trotz Corona. Und gerade unter Corona-Bedingungen. In den letzten Tagen vor dem November-Lockdown hatte die Kirchengemeinde ihr Programm noch einmal völlig umgestellt. Nun packten Konfirmanden der Gemeinde unter strengen Hygienebedingungen Päckchen für rund 20 Kinder der Gemeinde im Grundschulalter. In jedem Paket fanden sich drei liebevoll gestaltete kleinere Päckchen: für jeden Tag der verkürzten Bibelwoche Bastelideen oder Geschichten zum Thema „Tiere in der Bibel“. =>
„Spiele, die Spaß machen, dürfen nicht sein.“ Diese Klage hörte Pfarrerin Eva Forssmann, als sie die Kinderbibeltage der Kirchengemeinde Leutershausen zusammen mit Dekanatsjugendreferentin Anna Wiemer und Pfarrerin Teresa Sichermann vorbereitete. In der ersten Hälfte der Herbstferien luden sie dazu ein – trotz Corona. Und gerade unter Corona-Bedingungen. In den letzten Tagen vor dem November-Lockdown hatte die Kirchengemeinde ihr Programm noch einmal völlig umgestellt. Nun packten Konfirmanden der Gemeinde unter strengen Hygienebedingungen Päckchen für rund 20 Kinder der Gemeinde im Grundschulalter. In jedem Paket fanden sich drei liebevoll gestaltete kleinere Päckchen: für jeden Tag der verkürzten Bibelwoche Bastelideen oder Geschichten zum Thema „Tiere in der Bibel“. =>
Lebensbaum zeigt Trauer um Bellette
 Er ist unscheinbar und beschädigt – ein Steinpfeiler mit einem kaum mehr erkennbaren Lebensbaum und verwitterten Buchstaben. In der prunkvollen Mainzer Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ mit ihren rund 330 Exponaten aus den fünf Jahrhunderten zwischen Karl dem Großen und den Stauferkaisern, mit ihren Goldschätzen und prachtvollen Liederhandschriften wie dem Codex Manesse fällt es kaum auf. Sicher ist die Landesausstellung am Rhein auch jetzt von den Corona-Beschränkungen betroffen wie so viele kulturelle Ereignisse landauf, landab. Und doch ist die Stele besonders anrührend: die Totenklage um ein 13-jähriges Mädchen. =>
Er ist unscheinbar und beschädigt – ein Steinpfeiler mit einem kaum mehr erkennbaren Lebensbaum und verwitterten Buchstaben. In der prunkvollen Mainzer Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ mit ihren rund 330 Exponaten aus den fünf Jahrhunderten zwischen Karl dem Großen und den Stauferkaisern, mit ihren Goldschätzen und prachtvollen Liederhandschriften wie dem Codex Manesse fällt es kaum auf. Sicher ist die Landesausstellung am Rhein auch jetzt von den Corona-Beschränkungen betroffen wie so viele kulturelle Ereignisse landauf, landab. Und doch ist die Stele besonders anrührend: die Totenklage um ein 13-jähriges Mädchen. =>
Können Roboter Bewusstsein erlangen?
 Kann eine „Künstliche Intelligenz, also kurz KI“ ein Bewusstsein entwickeln? Was würde das für den Menschen bedeuten? Dabei ist dann erst einmal zu klären, was überhaupt „Bewusstsein“ bedeutet. Der Wissenschaftspodcast „Selbstbewusste KI“ der Forschungsgruppe „KI-Bewusstsein“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellt sich diesen Herausforderungen. In zwölf Folgen nähern sich Expertinnen und Experten aus der Robotik, aber auch aus den Fachgebieten Psychologie, Philosophie, Jura, Technikgeschichte, Neurowissenschaften oder Theologie dieser Frage. Professor Karsten Wendland, der am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des KIT zum Thema Computer und Bewusstsein forscht, hat die Reihe initiiert. Er führt auch die Interviews. =>
Kann eine „Künstliche Intelligenz, also kurz KI“ ein Bewusstsein entwickeln? Was würde das für den Menschen bedeuten? Dabei ist dann erst einmal zu klären, was überhaupt „Bewusstsein“ bedeutet. Der Wissenschaftspodcast „Selbstbewusste KI“ der Forschungsgruppe „KI-Bewusstsein“ des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellt sich diesen Herausforderungen. In zwölf Folgen nähern sich Expertinnen und Experten aus der Robotik, aber auch aus den Fachgebieten Psychologie, Philosophie, Jura, Technikgeschichte, Neurowissenschaften oder Theologie dieser Frage. Professor Karsten Wendland, der am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des KIT zum Thema Computer und Bewusstsein forscht, hat die Reihe initiiert. Er führt auch die Interviews. =>
Überfremdung, Dankopfer oder Austausch?
 Fast drei Jahrhunderte und der ganze Weltkreis sind auf wenigen Quadratmetern vereint: Das Rummelsberger Diakoniemuseum hat die neue Ausstellung „Ferne Nächste“ im Diakoniemuseum in Rummelsberg eröffnet. Ein Berg an klobigen Koffern und Reisekisten zieht die Gäste in die Ausstellung hinein. Es sind originale Gepäckstücke der Missionare, mit denen sie in alle Welt unterwegs waren. Was hatten die ausgesandten Missionare und Diakonissen, Ärztinnen und Piloten im Gepäck? Die christliche Botschaft sicher. Daneben aber auch umfangreiche medizinische Kenntnisse und umfassende Hilfsbereitschaft. Im Untertitel vermeidet die Schau bewusst das Wort „Mission“, sondern präsentiert „Weltweite Diakonie aus Bayern“. =>
Fast drei Jahrhunderte und der ganze Weltkreis sind auf wenigen Quadratmetern vereint: Das Rummelsberger Diakoniemuseum hat die neue Ausstellung „Ferne Nächste“ im Diakoniemuseum in Rummelsberg eröffnet. Ein Berg an klobigen Koffern und Reisekisten zieht die Gäste in die Ausstellung hinein. Es sind originale Gepäckstücke der Missionare, mit denen sie in alle Welt unterwegs waren. Was hatten die ausgesandten Missionare und Diakonissen, Ärztinnen und Piloten im Gepäck? Die christliche Botschaft sicher. Daneben aber auch umfangreiche medizinische Kenntnisse und umfassende Hilfsbereitschaft. Im Untertitel vermeidet die Schau bewusst das Wort „Mission“, sondern präsentiert „Weltweite Diakonie aus Bayern“. =>
Dichter zwischen den Zeiten
 Direkt an „seiner“ Straße liegt die Volkshochschule Ansbach. Zufall? Dem Dichter Johann Peter Uz lag die Bildung ganz besonders am Herzen. Vor genau 300 Jahren, am 3. Oktober 1720, erblickte er das Licht der Welt. Wie viele andere Denker seiner Epoche beeindruckte auch Uz das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 tief. Warum kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum überdies zu Allerheiligen? Und wieso waren gerade Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber das Rotlichtviertel verschont geblieben? Gelehrte wie Voltaire, Kant und Lessing diskutierten diese Fragen. Auch Johann Peter Uz gestaltete seine poetische „Theodicee“. =>
Direkt an „seiner“ Straße liegt die Volkshochschule Ansbach. Zufall? Dem Dichter Johann Peter Uz lag die Bildung ganz besonders am Herzen. Vor genau 300 Jahren, am 3. Oktober 1720, erblickte er das Licht der Welt. Wie viele andere Denker seiner Epoche beeindruckte auch Uz das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 tief. Warum kann ein allmächtiger und gütiger Gott ein so gewaltiges Unglück wie das Erdbeben von Lissabon zulassen? Warum überdies zu Allerheiligen? Und wieso waren gerade Kirchen dem Beben zum Opfer gefallen, aber das Rotlichtviertel verschont geblieben? Gelehrte wie Voltaire, Kant und Lessing diskutierten diese Fragen. Auch Johann Peter Uz gestaltete seine poetische „Theodicee“. =>
Glaubenskrise oder Glaubensvertiefung?
 Die Zeit der Stille als Zeit der Besinnung – das ist für die christliche Tradition kein neuer Gedanke. In den vergangenen Monaten gewann er jedoch eine ganz brisante Aktualität. Selbstredend waren die Wochen des Corona-Lockdowns eine intensive Krisenzeit, wie sie seit langem unvorstellbar war. Hinter sorgfältig verschlossenen Vorhängen griffen landauf, landab wohl in unzähligen Wohnungen und Häusern Ängste und Depressionen um sich. Auch Tagungshäusern und Diskussionsrunden fehlte immer mehr die notwendige Luft zum Atmen. Viele von ihnen verlagerten die Gemeinschaft ins Netz. Zoom-Seminare und Online-Andachten schufen eine Nähe, die es in der realen Welt nicht mehr geben konnte. „Die Erde wehrt sich“: Unter diesem Titel fassten die Theologen Klara Butting und Gerard Minnaard zwölf „Besinnungen in besonderen Zeiten“ zusammen. =>
Die Zeit der Stille als Zeit der Besinnung – das ist für die christliche Tradition kein neuer Gedanke. In den vergangenen Monaten gewann er jedoch eine ganz brisante Aktualität. Selbstredend waren die Wochen des Corona-Lockdowns eine intensive Krisenzeit, wie sie seit langem unvorstellbar war. Hinter sorgfältig verschlossenen Vorhängen griffen landauf, landab wohl in unzähligen Wohnungen und Häusern Ängste und Depressionen um sich. Auch Tagungshäusern und Diskussionsrunden fehlte immer mehr die notwendige Luft zum Atmen. Viele von ihnen verlagerten die Gemeinschaft ins Netz. Zoom-Seminare und Online-Andachten schufen eine Nähe, die es in der realen Welt nicht mehr geben konnte. „Die Erde wehrt sich“: Unter diesem Titel fassten die Theologen Klara Butting und Gerard Minnaard zwölf „Besinnungen in besonderen Zeiten“ zusammen. =>

