 Sie ist das größte Ausstellungsstück einer prunkvollen Schau: Die Moritzburg in Halle selbst, Sitz des örtlichen Kunstmuseums und nun der Sonderausstellung zur Frührenaissance. 1479 begann ihr imposanter Ausbau durch den jungen Ernst II., Erzbischof von Magdeburg. Als Elfjähriger kam er bereits Anfang 1475 in dies Amt. Denn er entstammte der Fürstenfamilie der Wettiner, deren Territorien an die Magdeburger Gebiete angrenzten. Damit war er der jüngere Bruder Friedrichs des Weisen (* 1463) . Da lohnt sich auch eine Beschäftigung mit ihm. =>
Sie ist das größte Ausstellungsstück einer prunkvollen Schau: Die Moritzburg in Halle selbst, Sitz des örtlichen Kunstmuseums und nun der Sonderausstellung zur Frührenaissance. 1479 begann ihr imposanter Ausbau durch den jungen Ernst II., Erzbischof von Magdeburg. Als Elfjähriger kam er bereits Anfang 1475 in dies Amt. Denn er entstammte der Fürstenfamilie der Wettiner, deren Territorien an die Magdeburger Gebiete angrenzten. Damit war er der jüngere Bruder Friedrichs des Weisen (* 1463) . Da lohnt sich auch eine Beschäftigung mit ihm. =>
Reliquiensammler als Helfer der Reformation
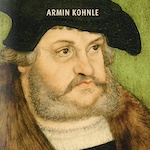 In Erinnerung blieb er vor allem als Beschützer Martin Luthers während der ersten stürmischen Jahre der Reformation. Doch diese Bewertung wird der Regierung Friedrichs des Weisen (*1463) nur teilweise gerecht – so Armin Kohnle. Im Vorfeld von Friedrichs 500. Todestages zum 5. Mai 1525 hat der Leipziger Kirchengeschichtler eine kompakte, denoch detailreiche und gut lesbare Biografie verfasst. Sicherlich war dem Kurfürsten seine Rolle als solcher Schutzherr nicht in die Wiege gelegt worden. Seine Frömmigkeit erscheint eher mittelalterlich. Schon 1493 erfüllte er sich wohl ein persönliches Bedürfnis: Er pilgerte ins Heilige Land. Schon von dieser Reise brachte er zahlreiche Reliquien mit. Sie bildeten den Grundstock für eine bald ausufernde Sammlung …. =>
In Erinnerung blieb er vor allem als Beschützer Martin Luthers während der ersten stürmischen Jahre der Reformation. Doch diese Bewertung wird der Regierung Friedrichs des Weisen (*1463) nur teilweise gerecht – so Armin Kohnle. Im Vorfeld von Friedrichs 500. Todestages zum 5. Mai 1525 hat der Leipziger Kirchengeschichtler eine kompakte, denoch detailreiche und gut lesbare Biografie verfasst. Sicherlich war dem Kurfürsten seine Rolle als solcher Schutzherr nicht in die Wiege gelegt worden. Seine Frömmigkeit erscheint eher mittelalterlich. Schon 1493 erfüllte er sich wohl ein persönliches Bedürfnis: Er pilgerte ins Heilige Land. Schon von dieser Reise brachte er zahlreiche Reliquien mit. Sie bildeten den Grundstock für eine bald ausufernde Sammlung …. =>
Bauernkrieg als Baby des Buchdrucks
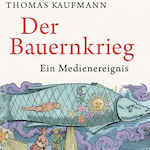 Es braute sich schon länger etwas zusammen: Heilsverlangen und Höllenangst, neuartige Krankheiten und vielfältige Krisen einer Umbruchszeit, Naturkatastrophen und himmlische Wunderzeichen führten vor 500 Jahren dazu, dass die Unterdrückten gegenüber der herrschenden Ungerechtigkeit aufbegehrten. In seinem aktuellen Werk „Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis“ stellt der Kirchenhistoriker ein umfassendes Bild der Umbrüche 1524/25 dar. Prophetische Warnungen vor diesem besonderen Unheilsjahr reichten teils eine ganze Generation zurück: Da nennt Kaufmann eine 1488 erschienene „Prognosticatio“ des Astrologen Johannes Lichtenberger: Orakel weisen für diesen auf kommendes Unheil hin – bevor sich Martin Luther überhaupt 1490 in die Mansfelder Lateinschule begab. … =>
Es braute sich schon länger etwas zusammen: Heilsverlangen und Höllenangst, neuartige Krankheiten und vielfältige Krisen einer Umbruchszeit, Naturkatastrophen und himmlische Wunderzeichen führten vor 500 Jahren dazu, dass die Unterdrückten gegenüber der herrschenden Ungerechtigkeit aufbegehrten. In seinem aktuellen Werk „Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis“ stellt der Kirchenhistoriker ein umfassendes Bild der Umbrüche 1524/25 dar. Prophetische Warnungen vor diesem besonderen Unheilsjahr reichten teils eine ganze Generation zurück: Da nennt Kaufmann eine 1488 erschienene „Prognosticatio“ des Astrologen Johannes Lichtenberger: Orakel weisen für diesen auf kommendes Unheil hin – bevor sich Martin Luther überhaupt 1490 in die Mansfelder Lateinschule begab. … =>
Schein und Sein in prunkvollen Spiegeln
 Er hatte anscheinend auf ganzer Linie gesiegt: Vor genau 400 Jahren, 1623, stand der bayerische Herzog Maximilian I. auf dem Höhepunkt seiner Macht: Feierlich übertrug ihm der Habsburger Kaiser Ferdinand II. die Kurwürde anstelle des geächteten Friedrichs von der Pfalz. Dieser Staatsakt zeigte, wie eng die katholischen Dynastien der Habsburger und Wittelsbacher an der Gegenreformation wirkten – und ohne Herzog Max ging schier gar nichts mehr: Er hatte den Pfälzer „Winterkönig“ bei der Schlacht am Weißen Berg vor Prag geschlagen – und mit ihm die protestantische Seite gleich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Trieben die Reformatoren nicht hilflos im Wasser, während das Schiff der rechtmäßigen Kirche majestätisch vorbeisegelte? =>
Er hatte anscheinend auf ganzer Linie gesiegt: Vor genau 400 Jahren, 1623, stand der bayerische Herzog Maximilian I. auf dem Höhepunkt seiner Macht: Feierlich übertrug ihm der Habsburger Kaiser Ferdinand II. die Kurwürde anstelle des geächteten Friedrichs von der Pfalz. Dieser Staatsakt zeigte, wie eng die katholischen Dynastien der Habsburger und Wittelsbacher an der Gegenreformation wirkten – und ohne Herzog Max ging schier gar nichts mehr: Er hatte den Pfälzer „Winterkönig“ bei der Schlacht am Weißen Berg vor Prag geschlagen – und mit ihm die protestantische Seite gleich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Trieben die Reformatoren nicht hilflos im Wasser, während das Schiff der rechtmäßigen Kirche majestätisch vorbeisegelte? =>
