 Digitale Zwillinge oder Avatare, also virtuelle Abbilder von Verstorbenen, eröffnen neue Möglichkeiten, Erinnerungen zu bewahren – und werfen zugleich tiefgreifende ethische, psychologische und ökonomische Fragen auf. Die Idee, mit einem geliebten Menschen sprechen zu können, auch wenn dieser längst tot ist, fasziniert viele und erscheint tröstlich. Gleichzeitig erscheint es als unheimlich, mit einer Person zu sprechen, die nicht mehr auf dieser Erde weilt: Die Stimme klingt vertraut. Warm, ruhig, ein wenig ironisch, wie immer. Sie erzählt Anekdoten aus einem längst vergangenen Urlaub – wie die Frau vor dem Bildschirm als kleines Mädchen bei einer Bergwanderung auf einer glitschigen Brücke dermaßen herumturnte, dass es fast in den kalten Bach gestürzt wäre. Gerade rechtzeitig konnte ihr Vater sie noch halten. … =>
Digitale Zwillinge oder Avatare, also virtuelle Abbilder von Verstorbenen, eröffnen neue Möglichkeiten, Erinnerungen zu bewahren – und werfen zugleich tiefgreifende ethische, psychologische und ökonomische Fragen auf. Die Idee, mit einem geliebten Menschen sprechen zu können, auch wenn dieser längst tot ist, fasziniert viele und erscheint tröstlich. Gleichzeitig erscheint es als unheimlich, mit einer Person zu sprechen, die nicht mehr auf dieser Erde weilt: Die Stimme klingt vertraut. Warm, ruhig, ein wenig ironisch, wie immer. Sie erzählt Anekdoten aus einem längst vergangenen Urlaub – wie die Frau vor dem Bildschirm als kleines Mädchen bei einer Bergwanderung auf einer glitschigen Brücke dermaßen herumturnte, dass es fast in den kalten Bach gestürzt wäre. Gerade rechtzeitig konnte ihr Vater sie noch halten. … =>
Zwischen Trost und Täuschung
 Wollte sie mit ihm Kontakt aufnehmen? Auf ein Selbstporträt des amerikanischen Fotographen William H. Mumler schmuggelte sich bereits um 1860 eine verschwommene Frauengestalt. Sie war gar nicht bei der Aufnahme dabei gewesen. Zunächst glaubte Mumler darin den Geist seiner verstorbenen Cousine zu erkennen: Wollte sie mit ihm über das magische Medium der Fotoplatte in Verbindung bleiben? Nach dem ersten wohligen Grusel erkannte der Profi: Es war eine versehentliche Doppelbelichtung einer Fotoplatte, die er nicht gründlich gereinigt hatte. Kein Porträt einer Toten, dafür die Geburt einer Geschäftsidee. =>
Wollte sie mit ihm Kontakt aufnehmen? Auf ein Selbstporträt des amerikanischen Fotographen William H. Mumler schmuggelte sich bereits um 1860 eine verschwommene Frauengestalt. Sie war gar nicht bei der Aufnahme dabei gewesen. Zunächst glaubte Mumler darin den Geist seiner verstorbenen Cousine zu erkennen: Wollte sie mit ihm über das magische Medium der Fotoplatte in Verbindung bleiben? Nach dem ersten wohligen Grusel erkannte der Profi: Es war eine versehentliche Doppelbelichtung einer Fotoplatte, die er nicht gründlich gereinigt hatte. Kein Porträt einer Toten, dafür die Geburt einer Geschäftsidee. =>
Vom Aufruhr zur Einkehr
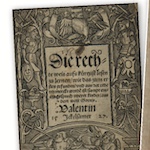 „Je näher an Wittenberg, desto schlimmer die Christen.“ Mit diesen beißenden Worten begann Valentin Ickelsamer seine Abrechnung mit der Reformation. Was Luther und seine Mitstreiter einst Rom vorgeworfen hätten, gelte längst auch für sie selbst, schrieb er 1525 in seiner Flugschrift „Clag etlicher brüder“. Während Luther, in seiner Stube Bier trinke, so Ickelsamer, hungerten draußen die Armen. Seine Worte waren Sprengstoff – und sie trafen mitten in eine Zeit, in der Glauben, Macht und Aufruhr ein explosives Gemisch bildeten. Im März 1525, als die „Clag“ erschien, stand auch Ickelsamers Heimat Rothenburg ob der Tauber am Rand des Abgrunds. Überall gärte der Zorn der Bauern, die gegen Unterdrückung und kirchliche Bevormundung aufbegehrten. =>
„Je näher an Wittenberg, desto schlimmer die Christen.“ Mit diesen beißenden Worten begann Valentin Ickelsamer seine Abrechnung mit der Reformation. Was Luther und seine Mitstreiter einst Rom vorgeworfen hätten, gelte längst auch für sie selbst, schrieb er 1525 in seiner Flugschrift „Clag etlicher brüder“. Während Luther, in seiner Stube Bier trinke, so Ickelsamer, hungerten draußen die Armen. Seine Worte waren Sprengstoff – und sie trafen mitten in eine Zeit, in der Glauben, Macht und Aufruhr ein explosives Gemisch bildeten. Im März 1525, als die „Clag“ erschien, stand auch Ickelsamers Heimat Rothenburg ob der Tauber am Rand des Abgrunds. Überall gärte der Zorn der Bauern, die gegen Unterdrückung und kirchliche Bevormundung aufbegehrten. =>
Pfade der Vergänglichkeit neu erforschen
 Ihre Kunst erblüht in den Farben des Herbstes – Brauntöne überwiegen. Schließlich gehören getrocknete Blätter zu den wichtigsten Elementen, aus denen Anna Hielscher schöpft – daneben aber auch welke Blüten oder Nussschalen. Wichtig ist der Nürnberger Künstlerin jedoch: Nichts darf den Bäumen oder Blumen gewaltsam entrissen werden. Also heißt es abzuwarten, bis die Natur ihre Schätze selbst schenkt. Gerade in diesen Wochen wird Hielscher reich bedacht: Dann sammelt, presst und konserviert sie diese Kostbarkeiten, die zu ihren – und unseren – Füßen liegen, aber oft unterwegs übersehen werden. Sie schafft aus ihnen kleine Schmuckstücke … =>
Ihre Kunst erblüht in den Farben des Herbstes – Brauntöne überwiegen. Schließlich gehören getrocknete Blätter zu den wichtigsten Elementen, aus denen Anna Hielscher schöpft – daneben aber auch welke Blüten oder Nussschalen. Wichtig ist der Nürnberger Künstlerin jedoch: Nichts darf den Bäumen oder Blumen gewaltsam entrissen werden. Also heißt es abzuwarten, bis die Natur ihre Schätze selbst schenkt. Gerade in diesen Wochen wird Hielscher reich bedacht: Dann sammelt, presst und konserviert sie diese Kostbarkeiten, die zu ihren – und unseren – Füßen liegen, aber oft unterwegs übersehen werden. Sie schafft aus ihnen kleine Schmuckstücke … =>
Gewalt als Basis des Glaubens?
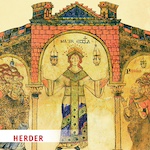 „Tötet sie alle, der Herr wird die Seinen erkennen.“ So soll der päpstliche Legat Arnaud Amaury 1209 den Befehl zum Massaker in Béziers gegeben haben. Der Glaube legitimierte die Gewalt – und umgekehrt. Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold schlägt auf 400 Seiten Text in anschaulicher und leicht nachvollziehbarer Sprache Schneisen ins Dickicht mittelalterlicher Glaubensgeschichte. Er zeigt mentalitätsgeschichtlich, wie die mittelalterliche Kirche zunehmend zur Machtinstanz wurde. =>
„Tötet sie alle, der Herr wird die Seinen erkennen.“ So soll der päpstliche Legat Arnaud Amaury 1209 den Befehl zum Massaker in Béziers gegeben haben. Der Glaube legitimierte die Gewalt – und umgekehrt. Der Augsburger Historiker Martin Kaufhold schlägt auf 400 Seiten Text in anschaulicher und leicht nachvollziehbarer Sprache Schneisen ins Dickicht mittelalterlicher Glaubensgeschichte. Er zeigt mentalitätsgeschichtlich, wie die mittelalterliche Kirche zunehmend zur Machtinstanz wurde. =>
Wenn sich selbst Jesus unbarmherzig zeigt …
 Ist das nicht hart? Da kommt Jesu Familie zu ihm – und er weist sie brüsk zurück. „Draußen“ müssen sie bleiben. Anstatt Mutter und Brüder hereinzubitten, erklärt er die Menschen in dem Kreis um ihn herum zu seiner eigentlichen Familie. Fast klingt es, als verspottete er die Seinen. Warum nur diese Schroffheit? Ein Blick zurück macht die Situation verständlicher: Zehn Verse zuvor sind die Gründe gerannt: Mutter und Brüder „wollen ihn festhalten, denn sie sprachen: Er ist von Sinnen“ (Markus 3,21). Sie wollen Jesus schon so kurz nach dem Beginn seines unkonventionellen Wirkens wieder in ihre geordnete kleine Welt zurückbringen. … =>
Ist das nicht hart? Da kommt Jesu Familie zu ihm – und er weist sie brüsk zurück. „Draußen“ müssen sie bleiben. Anstatt Mutter und Brüder hereinzubitten, erklärt er die Menschen in dem Kreis um ihn herum zu seiner eigentlichen Familie. Fast klingt es, als verspottete er die Seinen. Warum nur diese Schroffheit? Ein Blick zurück macht die Situation verständlicher: Zehn Verse zuvor sind die Gründe gerannt: Mutter und Brüder „wollen ihn festhalten, denn sie sprachen: Er ist von Sinnen“ (Markus 3,21). Sie wollen Jesus schon so kurz nach dem Beginn seines unkonventionellen Wirkens wieder in ihre geordnete kleine Welt zurückbringen. … =>
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“
 Hiob fragt beharrlich weiter. Und dies, obwohl seine Freunde schon ganz genau den Grund seines Leidens kennen: Irgendwo, zumindest unbewusst muss er Schuld auf sich geladen haben! Bereits die Propheten wettern ja ständig, dass Leiden und Verbannung die Konsequenz aus gottlosem Tun sind. Doch so klug sie auch reden – sie helfen dem Freund gerade nicht in seiner Not. Aus dem Anfang der Geschichte wissen wir: Hiob kann wirklich nichts für sein Leid. Der Satan will zeigen, dass er nur deshalb fromm ist, weil es ihm gut geht. Hiob ringt weiter mit diesem Gott, der sich ihm völlig ins Dunkle entzieht. =>
Hiob fragt beharrlich weiter. Und dies, obwohl seine Freunde schon ganz genau den Grund seines Leidens kennen: Irgendwo, zumindest unbewusst muss er Schuld auf sich geladen haben! Bereits die Propheten wettern ja ständig, dass Leiden und Verbannung die Konsequenz aus gottlosem Tun sind. Doch so klug sie auch reden – sie helfen dem Freund gerade nicht in seiner Not. Aus dem Anfang der Geschichte wissen wir: Hiob kann wirklich nichts für sein Leid. Der Satan will zeigen, dass er nur deshalb fromm ist, weil es ihm gut geht. Hiob ringt weiter mit diesem Gott, der sich ihm völlig ins Dunkle entzieht. =>
Aus vereinten Wurzeln den Aufbruch wagen
 „Wir wollen die Partnerschaft nach gut 40 Jahren in die neue Generation tragen“, erklärt Klaus Eberius. Er ist nicht nur Pfarrer in Schillingsfürst, sondern auch Partnerschaftsbeauftragter des Dekanats Rothenburg mit dem Dekanat Hai in Tansania. Direkt an den Hängen des Kilimandscharo gelegen, umfasst Hai inzwischen 49 Gemeinden mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Der damalige Rothenburger Dekan Johannes Rau und seine afrikanischen Partner legten 1982 das Fundament für diese Beziehung zwischen zwei Kirchen auf zwei Kontinenten.
„Wir wollen die Partnerschaft nach gut 40 Jahren in die neue Generation tragen“, erklärt Klaus Eberius. Er ist nicht nur Pfarrer in Schillingsfürst, sondern auch Partnerschaftsbeauftragter des Dekanats Rothenburg mit dem Dekanat Hai in Tansania. Direkt an den Hängen des Kilimandscharo gelegen, umfasst Hai inzwischen 49 Gemeinden mit mehr als 100.000 Mitgliedern. Der damalige Rothenburger Dekan Johannes Rau und seine afrikanischen Partner legten 1982 das Fundament für diese Beziehung zwischen zwei Kirchen auf zwei Kontinenten.
Ab Mitte September soll diese Verbindung eine neue Tiefe bekommen: Sechs junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren reisen aus Tansania ins Taubertal – drei Frauen und drei Männer … =>
Filmreif verwickelt
 Ein Stück im Stück – genauer: ein Film im Freilandtheater: Diese komplexe Erzählkonstruktion wagt das Freilandtheater mit seinem aktuellen Stück „Abgedreht“. Die Rahmenhandlung spielt im Jahr 1927 in einem mittelfränkischen Dorf, das um seine Zukunft bangt. Der Bürgermeister hat eine neuartige Idee: Ein Berliner Filmteam soll ein Historiendrama drehen – und zwar direkt in der Dorfidylle. Schließlich hat ein Dorfbursche begonnen, als Kameramann in der weiten Welt Karriere zu machen. Und welche Rolle spielt da ein dunkler und blinder Kapuzenmann? =>
Ein Stück im Stück – genauer: ein Film im Freilandtheater: Diese komplexe Erzählkonstruktion wagt das Freilandtheater mit seinem aktuellen Stück „Abgedreht“. Die Rahmenhandlung spielt im Jahr 1927 in einem mittelfränkischen Dorf, das um seine Zukunft bangt. Der Bürgermeister hat eine neuartige Idee: Ein Berliner Filmteam soll ein Historiendrama drehen – und zwar direkt in der Dorfidylle. Schließlich hat ein Dorfbursche begonnen, als Kameramann in der weiten Welt Karriere zu machen. Und welche Rolle spielt da ein dunkler und blinder Kapuzenmann? =>
Madonna und Monster, Muse und Mächtige?
 Selig betrachtet sie ihr Kind: Die gotische Madonnenfigur aus der Zeit um 1400 genauso wie die „Stillende Mutter“ von Paula Modersohn-Becker ein halbes Jahrtausend später. Zwar erschien letztere bei ihrer Entstehung fast schockierend entblößt, doch in ihrer inneren Ausrichtung auf ihr Baby übertrifft sie viele Madonnen. Und dies auch, obwohl ihr Kind den Blick von ihr und der Nahrungsquelle abgewendet hat und anscheinend geradewegs auf uns Betrachtende aus dem Bild herausschaut. Dies sind nur zwei von 120 Exponaten aus sechs Jahrhunderten, die die Ausstellung „Mama – von Maria bis Merkel“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt. Ein drittes Werk spannt den Bogen weiter … =>
Selig betrachtet sie ihr Kind: Die gotische Madonnenfigur aus der Zeit um 1400 genauso wie die „Stillende Mutter“ von Paula Modersohn-Becker ein halbes Jahrtausend später. Zwar erschien letztere bei ihrer Entstehung fast schockierend entblößt, doch in ihrer inneren Ausrichtung auf ihr Baby übertrifft sie viele Madonnen. Und dies auch, obwohl ihr Kind den Blick von ihr und der Nahrungsquelle abgewendet hat und anscheinend geradewegs auf uns Betrachtende aus dem Bild herausschaut. Dies sind nur zwei von 120 Exponaten aus sechs Jahrhunderten, die die Ausstellung „Mama – von Maria bis Merkel“ im Düsseldorfer Kunstpalast zeigt. Ein drittes Werk spannt den Bogen weiter … =>
